Clean Space Coaching: Erkenntnisse im Raum
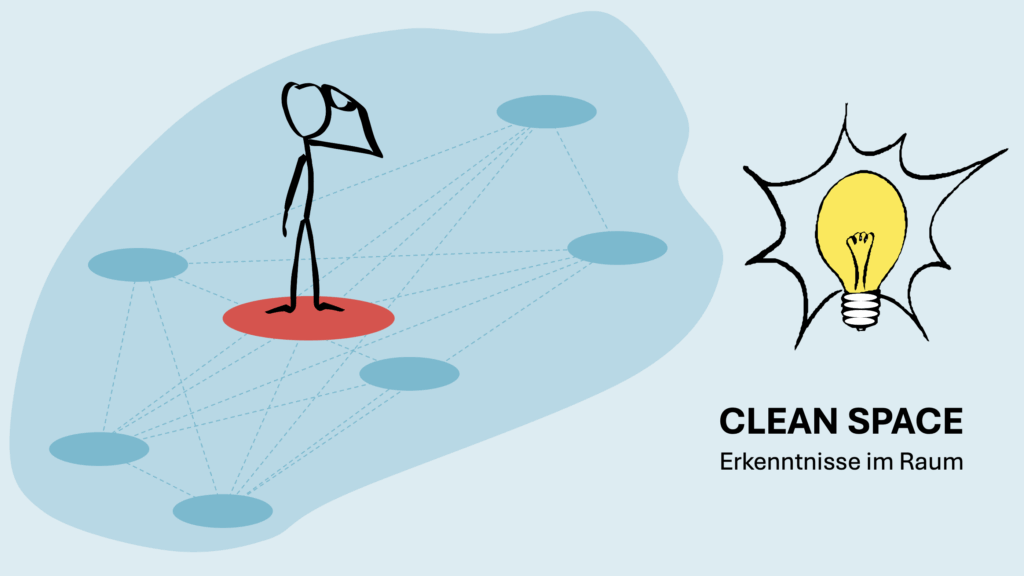
Manchmal entsteht Klarheit nicht durch weiteres Nachdenken, sondern durch Bewegung und durch Erkenntnisse im Raum.
Clean Space ist ein strukturierter, aber überraschend stiller Prozess, bei dem Gedanken, Gefühle und innere Bilder im Raum sichtbar gemacht und verortet werden. Durch das bewusste Einnehmen verschiedener Positionen und das Ordnen im Raum entsteht ein neues Verständnis für das eigene Anliegen – ob im Einzel- oder im Teamcoaching.
Der folgende Beitrag stellt diese besondere Coaching-Methode vor: Was sie ausmacht, wie sie abläuft und in welchen Situationen sie hilfreich sein kann. Sie erfahren, wie Clean Space zu mehr Klarheit, Fokus und Erkenntnis führt.
Der Blogbeitrag gliedert sich wie folgt auf:
- Clean Space: Neue Perspektiven gewinnen
- Was Clean Space ausmacht
- Clean Space im Einzelcoaching
- Clean Space im Teamcoaching
- Einsatzfelder und Nutzen von Clean Space
- Zusammenfassung
- Abschluss mit Video
Ich wünsche gute Inspiration!
Clean Space: Neue Perspektiven gewinnen
Wenn Denken stecken bleibt
Manchmal scheint der Kopf wie blockiert zu sein – die Gedanken drehen sich im Kreis, Lösungen rücken in weite Ferne. Dieses Gefühl, das wir sprichwörtlich als „ein Brett vorm Kopf haben“ bezeichnen, kennen viele. Je stärker wir versuchen, das Problem zu durchdenken, desto enger wird der Tunnel. Alles bleibt im selben gedanklichen Raum.
Friedrich Nietzsche schrieb: „Alle wahrhaft großen Gedanken kommen einem beim Gehen.“
Und tatsächlich – sobald wir uns bewegen, gerät auch der Geist in Bewegung. Ein Schritt zur Seite, ein anderer Blickwinkel, ein Perspektivwechsel im Raum: Plötzlich entsteht neue Klarheit. Der Körper hilft dem Denken, aus festgefahrenen Bahnen auszubrechen.
Während es im Einzelcoaching häufig darum geht, dieses „Brett vorm Kopf“ zu lösen, steht im Teamcoaching etwas anderes im Vordergrund: Vielfalt sichtbar machen. Unterschiedliche Gedanken, Emotionen, Sichtweisen und Erfahrungen werden gemeinsam in den Raum gestellt, damit ein vollständigeres Bild des Anliegens entstehen kann. So zeigt sich, was bisher unsichtbar blieb – und das Team erkennt, dass jede Perspektive ein Teil des Ganzen ist.
Genau hier setzt Clean Space an – eine Methode, die Bewegung, Raum und Wahrnehmung nutzt, um Gedanken und Gefühle dort sichtbar zu machen, wo sie entstehen.
Bewegung schafft Erkenntnis
Bewegung verändert nicht nur unsere Position im Raum, sondern auch unsere Wahrnehmung. Wer den Platz wechselt, verändert automatisch den Blickwinkel – und mit ihm oft auch das Denken.
Neurowissenschaftlich lässt sich das gut erklären: Schon kleine Veränderungen in Haltung oder Orientierung aktivieren andere Areale im Gehirn. Das Denken wird flexibler, die Wahrnehmung offener, kreative Verknüpfungen entstehen leichter.
Viele Menschen erleben das intuitiv: Beim Gehen formt sich ein Gedanke, beim Aufstehen kommt eine Idee, beim Wechsel des Arbeitsplatzes eine neue Sichtweise. Bewegung löst das Denken aus der Enge des Stuhls – und öffnet einen Raum, in dem Kopf, Herz und Bauch gemeinsam arbeiten dürfen.
Im Coaching wird dieser Zusammenhang bewusst genutzt. Der physische Raum wird zum Resonanzraum für Erkenntnis. Wenn wir uns an verschiedene Orte begeben, nehmen wir automatisch verschiedene Perspektiven ein – auf uns selbst, auf ein Ziel oder auf ein Problem. Und genau darin liegt der Schlüssel: Nicht der Coach liefert die Lösung, sondern der Wechsel von Position, Haltung und Richtung bringt sie hervor.
Clean Space übersetzt dieses natürliche Prinzip in eine klare, strukturierte Form – und macht das „Denken in Bewegung“ zu einem bewussten, wirksamen Prozess.
Der Raum als Erkenntnispartner
Im Clean Space wird der Raum selbst zum Partner im Denkprozess. Anliegen, Gedanken und Gefühle werden buchstäblich in den Raum gestellt und aus unterschiedlichen Positionen betrachtet. Jeder Ort steht dabei für eine eigene Perspektive – mit einem eigenen Wissen, einer eigenen Energie, manchmal sogar einer eigenen Stimmung.
Der bewusste Wechsel zwischen diesen Orten ermöglicht es, das eigene Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu erleben – nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich. So entsteht eine Art Landkarte des Denkens, in der Zusammenhänge, Ressourcen und neue Wege sichtbar werden.
Auch andere Coaching-Formate nutzen räumliche Perspektivenwechsel: Etwa die Wahrnehmungspositionen im NLP, die Walt-Disney-Strategie oder der Mini-Change-Prozess. Clean Space geht jedoch einen Schritt weiter – hier wird der physische Raum selbst zum Erkenntnisfeld, in dem Denken, Fühlen und Intuition gleichzeitig aktiv werden.
Wer sich im Raum bewegt, bewegt auch sein Denken – und öffnet damit neue Wege zu Klarheit und Erkenntnis.
Was Clean Space ausmacht

Ursprung und Grundidee
Die Methode Clean Space geht auf den neuseeländischen Therapeuten David Grove zurück. In den 1980er-Jahren entwickelte Grove zunächst den Ansatz Clean Language – eine Gesprächsform, in der der Coach ausschließlich die Worte des Klienten verwendet, ohne eigene Deutungen einzubringen. Dadurch bleibt der Denkraum „clean“ – also frei von äußeren Einflüssen.
Später übertrug Grove dieses Prinzip in den physischen Raum. Er beobachtete, dass Menschen nicht nur in Worten, sondern auch in räumlichen Bildern denken: Sie „stehen zwischen zwei Optionen“ oder „sehen keinen Weg“. Clean Space nutzt genau diese räumliche Intelligenz. Der Klient bewegt sich im Raum, wählt Orte, an denen sich Gedanken oder Gefühle verändern, und entdeckt so neue Perspektiven auf sein Anliegen.
Die Grundidee bleibt dieselbe: Der Mensch trägt alles Wissen bereits in sich – Bewegung und Raum helfen, es sichtbar zu machen.
Der Charakter von Clean Space
Clean Space verbindet Klarheit mit Offenheit – ein strukturiertes Vorgehen, das zugleich Raum für Neues lässt. Seine Wirkung beruht auf fünf zentralen Prinzipien:
Struktur statt Steuerung:
Der Prozess folgt einem klaren Ablauf, doch die Inhalte entstehen ausschließlich aus dem Klienten heraus. Der Coach sorgt für den Rahmen, nicht für die Richtung. Dadurch bleibt das Denken frei und selbstorganisiert.
Neutralität:
Der Coach bringt keine eigenen Ideen, Bewertungen oder Erklärungen ein. Er hält sich bewusst zurück, stellt nur wenige, einfache Fragen – und schafft so einen Raum, in dem Erkenntnisse ungestört wachsen können.
Sprache des Klienten:
Die Worte des Klienten sind Leitfaden und Spiegel zugleich. Sie bilden den roten Faden, an dem sich der Prozess orientiert. Was ausgesprochen wird, erhält Gewicht – ohne dass es interpretiert oder umgedeutet wird.
Erkenntnisse, die sich zeigen dürfen:
Neue Einsichten entstehen nicht durch Nachdenken oder Analyse, sondern durch das bewusste Wahrnehmen im Raum. Bewegung, Abstand und unterschiedliche Blickwinkel lassen Gedanken und Gefühle auf natürliche Weise zusammenfinden.
Ganzheitliches Wahrnehmen:
Clean Space spricht Kopf, Herz und Körper gleichermaßen an. Durch die Verbindung von Denken, Fühlen und Spüren werden Erkenntnisse oft tiefer verstanden – und bleiben dadurch besser verankert.
Der Prozess in Kürze
Auch wenn Clean Space nach außen ruhig und schlicht wirkt, folgt der Ablauf einem klaren und durchdachten Aufbau. Der Prozess schafft einen sicheren Rahmen, in dem sich Gedanken und Erkenntnisse Schritt für Schritt entfalten können.
Einstieg und Vorgespräch
Am Anfang steht das Anliegen – das Thema, das der Klient oder das Team im Coaching betrachten möchte. Es kann eine Frage, ein Ziel, eine Entscheidung oder ein wiederkehrendes Muster sein. Gemeinsam wird das Anliegen so lange präzisiert, bis eine stimmige Formulierung gefunden ist.
In Teamcoachings spielt dieser erste Schritt eine besonders wichtige Rolle: Hier gilt es, ein Anliegen zu finden, das für alle Teilnehmenden relevant und gemeinsam tragfähig ist. Nur so kann der Prozess im weiteren Verlauf seine Wirkung entfalten.
Das Anliegen sichtbar machen
Das formulierte Anliegen wird auf eine Karte geschrieben – oft eine einfache Moderationskarte – und bildet den Ausgangspunkt des Prozesses. Dadurch bekommt das Thema eine konkrete, sichtbare Form.
Erklärung des Vorgehens
Bevor der eigentliche Prozess beginnt, erläutert der Coach den Ablauf. Die Teilnehmenden erfahren, dass sie sich frei im Raum bewegen werden, Orte finden dürfen, an denen sich Gedanken oder Gefühle verändern, und dass es dabei keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt. Dieses kurze Briefing schafft Sicherheit und fördert die Offenheit für das Unbekannte.
Der Prozess-Start
Das Anliegen wird im Raum platziert – zum Beispiel auf dem Boden oder auf einem Tisch. Die Person oder das Team stellt sich in Beziehung dazu auf (Ort 1). Von dort aus stellt der Coach einfache, offene Fragen wie:
„Und was weißt Du hier?“
„Und gibt es noch etwas, was Du hier über DAS weißt?“
„Und wie könnte dieser Ort heißen?
Anschließend werden weitere fünf Orte gefunden. Jeder dieser Orte steht für eine neue Perspektive, einen anderen Gedanken oder ein Gefühl. Die Antworten werden – falls gewünscht – auf Karten notiert.
Sobald alle Orte erkundet sind, werden sie miteinander verknüpft: Wege zwischen den Positionen werden bewusst gegangen, Zusammenhänge erkannt, Unterschiede wahrgenommen.
Der Abschluss
Zum Ende des Prozesses kehrt die Person (oder das Team) zum Ausgangspunkt zurück – zum Anliegen selbst. Aus dieser neuen Gesamtsicht heraus werden die wichtigsten Erkenntnisse gesammelt, benannt und integriert.
Im Einzelcoaching nimmt der Klient anschließend seine Karten wieder auf – symbolisch ein Zeichen dafür, dass er sein Wissen und seine Erkenntnisse „wieder mitnimmt“.
Clean Space folgt einer klaren Struktur – und doch verläuft jeder Prozess anders. Denn jedes Anliegen, jede Person und jedes System bringt eigene Themen und Dynamiken mit. Wie der Ablauf konkret gestaltet wird, hängt davon ab, ob mit einer Einzelperson oder mit einem Team gearbeitet wird.
Im nächsten Kapitel steht daher der Clean Space im Einzelcoaching im Mittelpunkt – dort, wo ein Anliegen im Raum Form und Richtung gewinnt.
Clean Space im Einzelcoaching

Nachfolgend stelle ich Clean Space ganz konkret durch die Vorstellung eines meiner Einzelcoachings vor.
Im Einzelcoaching entfaltet Clean Space seine ganze Tiefe. Der Prozess ist ruhig, klar strukturiert und dennoch offen für das, was sich zeigen will. Er macht innere Bilder sichtbar, verknüpft Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen – und schafft dadurch eine Form von Klarheit, die nicht erdacht, sondern erlebt wird.
Ein Beispiel zeigt, wie ein solcher Prozess ablaufen kann.
Das Anliegen
Das Anliegen des Klienten lautet: „Ich habe Klarheit, ob ich Teamcoach sein will.“
Hintergrundinformationen: Der Klient arbeitet bereits erfolgreich als Einzelcoach und überlegt, ob er künftig auch Gruppen und Teams begleiten möchte. Es ist kein Problem, das ihn beschäftigt, sondern eine Entscheidung, die er mit Bedacht treffen will: Möchte er seine Coaching-Dienstleistung auch im Kontext von Teamentwicklungen einsetzen.
Nachdem die Formulierung des Anliegens für den Klienten stimmig ist, schreibt er den Satz auf eine Moderationskarte und legt sie im Raum an eine Position, die sich für ihn passend anfühlt. So wird das Anliegen sichtbar und der Prozess beginnt.
Der erste Ort
Der Klient stellt sich in Bezug zu seiner Anliegen-Karte auf: Dem Ort 1.
Der Coach fragt:
Was weißt du hier über dein Anliegen?
Nach kurzem Innehalten antwortet der Klient:
Ich habe hierzu an sich schon erste Pflänzchen gesetzt.
Der Klient nennt diesen Ort „Beet“. Hier spürt er, dass das Thema nicht neu ist. Er hat bereits Erfahrungen gesammelt, kleine Schritte getan, Ideen gesät. Der Klient äußert weiter, dass das Bild „Beet“ ihm Wachstum und Entwicklung vermittelt.
Weitere Orte entstehen
Ich lade den Klienten ein, einen weiteren Ort zu finden – eine Position im Raum, an der er anderes über sein Anliegen weiß.
Schritt für Schritt entstehen sechs Orte:
Ort 1 – Beet:
Erste Schritte und Erfahrungen sind bereits gemacht.
Ort 2 – Ressourcen:
Hier erkennt der Klient, dass er durch Ausbildung, Methodenwissen und Praxiserfahrung bereits heute ein stabiles Fundament besitzt.
Ort 3 – Vielseitige Person:
An diesem Ort erinnert der Klient sich an seine Anpassungsfähigkeit und Offenheit für Neues.
Ort 4 – Neues Lernfeld:
Der Gedanke, als Teamcoach zu wirken, weckt Neugier und Begeisterung. Der Klient spürt Lust auf persönliches Wachstum.
Ort 5 – Ordentlicher Respekt:
Hier erwähnt der Klient eine „gewisse Zurückhaltung“ und Respekt vor der Aufgabe. Die Verantwortung, Gruppen zu begleiten, löst Respekt, aber keine Angst aus.
Ort 6 – Gutes Rollenverständnis:
An diesem Ort findet beschreibt der Klient ein Portion „Sicherheit“: Sein klares Verständnis seiner Rolle als Coach gibt ihm Orientierung und Halt.
Die Orte werden im Laufe des Prozesses im Raum mit Moderationskarten markiert. So entsteht eine erste „Landkarte“ des Denkens – ein sichtbares Abbild seiner inneren Welt.
Orte aufrufen, verändern und verknüpfen
Veränderung der Position der Orte (bei Bedarf)
Der Coach lädt den Klienten ein, die Orte erneut aufzusuchen. Denn Clean Space ist kein lineares Vorgehen: Jeder Ort kann mehrfach besucht werden, wenn sich etwas verändert oder vertieft. Der Klient bewegt sich also frei zwischen den Positionen, kehrt zu früheren Orten zurück und entdeckt neue Zusammenhänge.
Während dieses wiederholten Aufsuchens zeigt sich Dynamik. Ich frage:
Passt der Ort noch so, wie er liegt?
Und der Klient entscheidet, die Anordnung zu verändern oder sie beizubehalten. Er verschiebt einige Karten, sodass sie im Raum nun stimmiger wirken. Die räumliche Neuordnung spiegelt den inneren Prozess: Gedanken, die sich verändert haben, bekommen buchstäblich einen neuen Platz.
Veränderung der Benennung der Orte (bei Bedarf)
Auch die Benennung der Orte darf sich im Prozess verändern, wenn sich die Bedeutung wandelt. In diesem Coaching blieb die Namensgebung jedoch stabil – alle sechs Orte behielten ihre ursprünglichen Bezeichnungen.
Veränderungen beim Einzelcoaching "Teamcoach werden"
Was sich bei diesem Coaching deutlich verschoben hat, war das räumliche Verhältnis zueinander. So rückten „Beet“ und „Ressourcen“ näher zusammen, während „Ordentlicher Respekt“ etwas Abstand gewann – ein Zeichen für wachsende Zuversicht und Vertrauen in das eigene Können.
Der Coach begleitet diese Bewegung mit wenigen, neutralen Fragen:
Und jetzt, was weißt Du jetzt hier?
Und gibt es noch etwas, was Du hier über DAS weißt? (auf anderen Ort oder Anliegen weisend)
Und was weißt Du hier noch über …?
So entsteht ein lebendiges Netz aus Gedanken, Gefühlen und Bedeutungen. Der Klient entdeckt, dass sich seine Sichtweise mit jeder Bewegung im Raum erweitert.
Abschluss beim Anliegen
Zum Ende des Prozesses kehrt der Klient zu seiner Ausgangsposition zurück – zum Anliegen selbst. Ich frage:
Und wenn Du jetzt all das weißt (was du in diesem Raum erfahren hast), was weißt Du dann jetzt hier?
Und was für einen Unterschied macht es, ALL das zu wissen?
Und was für einen Unterschied macht es, all DAS zu wissen?
Mein Klient gibt sich hier (sinngemäß) folgende Antwort:
Ich weiß, dass ich es will – aber mit Bewusstsein. Ich gehe das Schritt für Schritt an. Ich bin bereit, mich in dieses neue Lernfeld hineinzubewegen.
Damit schließt der Prozess. Der Klient hebt nacheinander die Karten auf – als symbolische Geste dafür, dass er seine Erkenntnisse wieder bei sich sammelt.
Ergebnis und Wirkung
Clean Space hat hier keine Entscheidung „herbeigeführt“, sondern sie ermöglicht. Der Klient hat erfahren, dass sein Wunsch, als Teamcoach zu arbeiten, auf tragfähigen Grundlagen steht: Auf Erfahrung, Neugier, Respekt und einem klaren Rollenverständnis.
Die räumliche Arbeit hat ihm geholfen, das Thema nicht nur zu durchdenken, sondern zu erleben. Jede Bewegung war eine kleine Veränderung im Denken. Durch das wiederholte Aufsuchen und Neuordnen der Orte entstand Klarheit, die sich stimmig anfühlt – nicht theoretisch, sondern verkörpert.
Clean Space im Teamcoaching

Nachfolgend gebe ich einen Ausschnitt aus einem Teamcoaching wieder, in dem der Prozess Clean Space mit einer Gruppe von acht Personen durchgeführt wurde. Während Clean Space im Einzelcoaching vor allem individuelle Klarheit schafft, öffnet er im Teamkontext einen Raum für gemeinsames Denken – still, strukturiert und frei von Diskussionen. Jede Person arbeitet für sich, doch das gemeinsame Anliegen verbindet alle Teilnehmenden.
Einstieg und Anliegen
Zu Beginn des Coachings einigen sich die acht Teilnehmenden auf ein gemeinsames Thema, das für alle relevant ist. Nach kurzer Abstimmung lautet das Anliegen:
Wie erreichen wir eine gute, schnittstellenübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit?
Das Anliegen wird auf einer Moderationskarte notiert und im Raum platziert. Es bildet den Ausgangspunkt des Prozesses – den gemeinsamen Bezugspunkt, zu dem alle immer wieder zurückkehren können.
Ich gebe den Teilnehmenden noch folgenden wichtige Hinweis: Jede Person arbeitet individuell, in Stille, mit sich selbst und ihren Gedanken – immer in Bezug auf das gemeinsame Anliegen.
Die Orte entstehen
Die Teilnehmenden werden eingeladen, einen ersten Ort im Raum zu wählen: Eine Position, an der sie etwas über das Anliegen wissen. Der Coach stellt die gleichen Fragen wie im Einzelcoaching:
Und was weißt Du hier?
Und gibt es noch etwas, was Du hier über DAS (Deutung auf das Anliegen) weißt?
Und wie könnte dieser Ort heißen?
Die Antworten werden nicht ausgesprochen, sondern jeder Teilnehmende notiert sich seine Antworten auf Moderationskarten. Der Prozess bleibt also still, konzentriert und ungestört.
Nach und nach entstehen weitere Orte; in diesem Fall limitiere ich den Prozess auf vier Orte. Diese Begrenzung dient der Übersicht und verhindert, dass der Prozess zu komplex wird. Jede Person legt ihre Karten selbstständig aus, benennt ihre Orte und markiert sie im Raum. Letztlich entstehen acht individuelle „Landschaften des Denkens“, die sich gleichzeitig im selben Raum entfalten.
Orte aufrufen, verändern und verknüpfen
Nachdem alle Teilnehmenden ihre vier Orte gefunden und im Raum markiert haben, beginnt die nächste Phase: Das strukturierte Aufrufen und Verknüpfen der Orte. Ich leite diesen Teil des Prozesses Schritt für Schritt an – alle Teilnehmenden folgen denselben Anweisungen, arbeiten aber weiterhin still und individuell.
Die Teilnehmenden stehen noch an ihrem Ort 4. Ich stelle folgende Fragen und lasse jeweils Zeit für die individuellen Notizen der Teilnehmenden:
Und was weißt du jetzt noch über Ort 3?
Und was weißt du jetzt noch über Ort 2?
Und was weißt du jetzt noch über Ort 1?
Die Teilnehmenden nehmen sich Zeit, notieren ihre Antworten auf Moderationskarten und halten inne. Danach folgt die nächste Anweisung:
Und gehe jetzt zurück zu Ort 3.
Dort wiederhole ich das Vorgehen – mit neuen Bezügen:
Und was weißt Du jetzt hier?
Und was weißt Du jetzt noch über Ort 4?
Und was weißt du jetzt noch über Ort 2?
Und was weißt du jetzt noch über Ort 1?
So führt die Struktur die Teilnehmenden Schritt für Schritt durch ihr eigenes räumliches Netzwerk. Jeder Ort wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, jeder Gedanke mit den anderen verbunden. Diese Phase wirkt still, fast meditativ. Die Teilnehmenden beginnen, Zusammenhänge zu erkennen, Widersprüche zu spüren, neue Einsichten zu notieren. Durch die klare Anleitung bleibt der Prozess fokussiert und geordnet, während gleichzeitig individuelle Dynamik und innere Bewegung entstehen.
Während dieser Sequenz dürfen die Orte bei Bedarf verändert oder verschoben werden. Manche Teilnehmenden rücken Karten näher zusammen, andere schaffen Abstand. Auch die Umbenennung ist möglich, wenn sich im Laufe des Prozesses die Bedeutung eines Ortes verändert. In dieser Session blieben die Namen stabil, einige Positionen wurden jedoch neu arrangiert, um das innere Bild besser abzubilden.
Abschluss beim Anliegen
Nachdem alle ihre Orte erkundet und gegebenenfalls neu geordnet haben, sage ich:
Und gehe zurück zu Deinem Anliegen?
Und frage abschließend:
Und wenn Du jetzt all das weißt (was du in diesem Raum erfahren hast), was weißt Du dann jetzt hier?
Und was für einen Unterschied macht es, ALL das zu wissen?
Und was für einen Unterschied macht es, all DAS zu wissen?
Jede Person notiert für sich, was ihr wichtig geworden ist. Ohne Worte wird deutlich: Jede und jeder hat eine eigene Erkenntnis über das Thema Zusammenarbeit gewonnen.
Wirkung und nächste Schritte
An dieser Stelle endet das Clean Space im Teamcoaching.
Erst danach folgt – in einer separaten Phase – das Teilen der persönlichen Erkenntnisse und das Zusammenführen der Perspektiven. Die Gruppe tauscht sich aus und beschreibt, welche Muster oder wiederkehrenden Themen sichtbar geworden sind.
Häufig entsteht dabei ein starkes Gefühl von Gemeinsamkeit: Die Vielfalt der individuellen Gedanken führt zu einem breiteren, tieferen Verständnis des gemeinsamen Anliegens. Der Prozess schafft nicht durch Diskussion Einigkeit, sondern durch Sichtbarkeit. Clean Space im Teamcoaching ist damit kein Gruppen-Workshop im klassischen Sinn. Es ist ein stilles, hochstrukturiertes Format, das jedem Einzelnen Raum für eigene Wahrnehmung gibt und zugleich ein kollektives Bewusstsein fördert.
Einsatzfelder und Nutzen von Clean Space
Clean Space ist vielseitig einsetzbar – überall dort, wo Klarheit, neue Perspektiven oder Bewegung in festgefahrene Situationen gebracht werden sollen. Die Methode eröffnet Zugänge, die über reines Nachdenken hinausgehen – und eignet sich sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams.
Zielklärung und Entscheidungsfindung
Clean Space hilft, komplexe Fragen zu ordnen und innere Widersprüche sichtbar zu machen. Durch das Erkunden verschiedener Perspektiven entsteht ein klares Bild dessen, was wirklich wichtig ist.
Umgang mit Blockaden und Mustern
Ob Prüfungsangst, Aufschieberitis oder der sprichwörtliche „Energieräuber“ – Clean Space unterstützt dabei, hinderliche Gedanken oder Gewohnheiten aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Bewegung im Raum fördert Bewegung im Denken.
Anliegen rund um Selbstwirksamkeit und innere Stärke
Das Erleben, dass Erkenntnisse aus einem selbst heraus entstehen, stärkt Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und Entscheidungsfähigkeit. Der Prozess fördert Selbstorganisation statt Abhängigkeit von externen Lösungen.
Team- und Organisationsentwicklung
Im Teamkontext schafft Clean Space Transparenz: Unterschiedliche Sichtweisen, Emotionen und Annahmen werden gemeinsam sichtbar. So entsteht ein gemeinsames Verständnis für Ziele, Rollen und Prioritäten – besonders hilfreich in Veränderungsprozessen.
Clean Space wirkt leise, aber nachhaltig. Erkenntnisse werden nicht „erarbeitet“, sondern tauchen auf, wenn Raum, Bewegung und Aufmerksamkeit zusammenwirken – und genau das macht den Prozess so wirksam in Coaching, Führung und Teamentwicklung.
Zusammenfassung
Clean Space zeigt, wie sehr Denken, Wahrnehmen und Bewegen miteinander verbunden sind. Oft suchen wir Lösungen im Kopf – in Gesprächen, Analysen oder Strategien. Doch manchmal braucht es keinen weiteren Gedankengang, sondern einen Schritt zur Seite. Genau darin liegt die Kraft dieses Ansatzes: Erkenntnis entsteht nicht durch Erklärungen, sondern durch Erfahrung im Raum.
Der Prozess folgt einer klaren Struktur: Ein Anliegen wird sichtbar gemacht, im Raum platziert und aus verschiedenen Positionen betrachtet. Jede Bewegung, jeder Standort öffnet eine neue Sichtweise. Der Coach begleitet, ohne zu lenken. Es wird nichts gedeutet, nichts vorgegeben – die Worte und Wahrnehmungen des Klienten führen den Weg. Dadurch bleibt der Prozess „clean“: rein, klar und frei von äußeren Einflüssen.
Clean Space eignet sich für viele Themen: persönliche Entscheidungen, Zielklärung, der Umgang mit Blockaden, aber auch zur Teamentwicklung und Konfliktlösung. Besonders wirkungsvoll ist er dort, wo Worte allein nicht mehr weiterführen. Der Raum selbst wird zum Spiegel – er zeigt, was zwischen den Zeilen und jenseits des Gesagten liegt.
Wer einmal erlebt hat, wie sich ein Gedanke im Raum verändert, spürt den Unterschied: Erkenntnisse werden nicht „produziert“, sie entstehen – leise, überraschend und nachhaltig. Clean Space eröffnet damit eine Form von Lernen und Verstehen, die Kopf, Herz und Körper gleichermaßen einbezieht.
Denn manchmal genügt ein Schritt – und der Raum antwortet.
